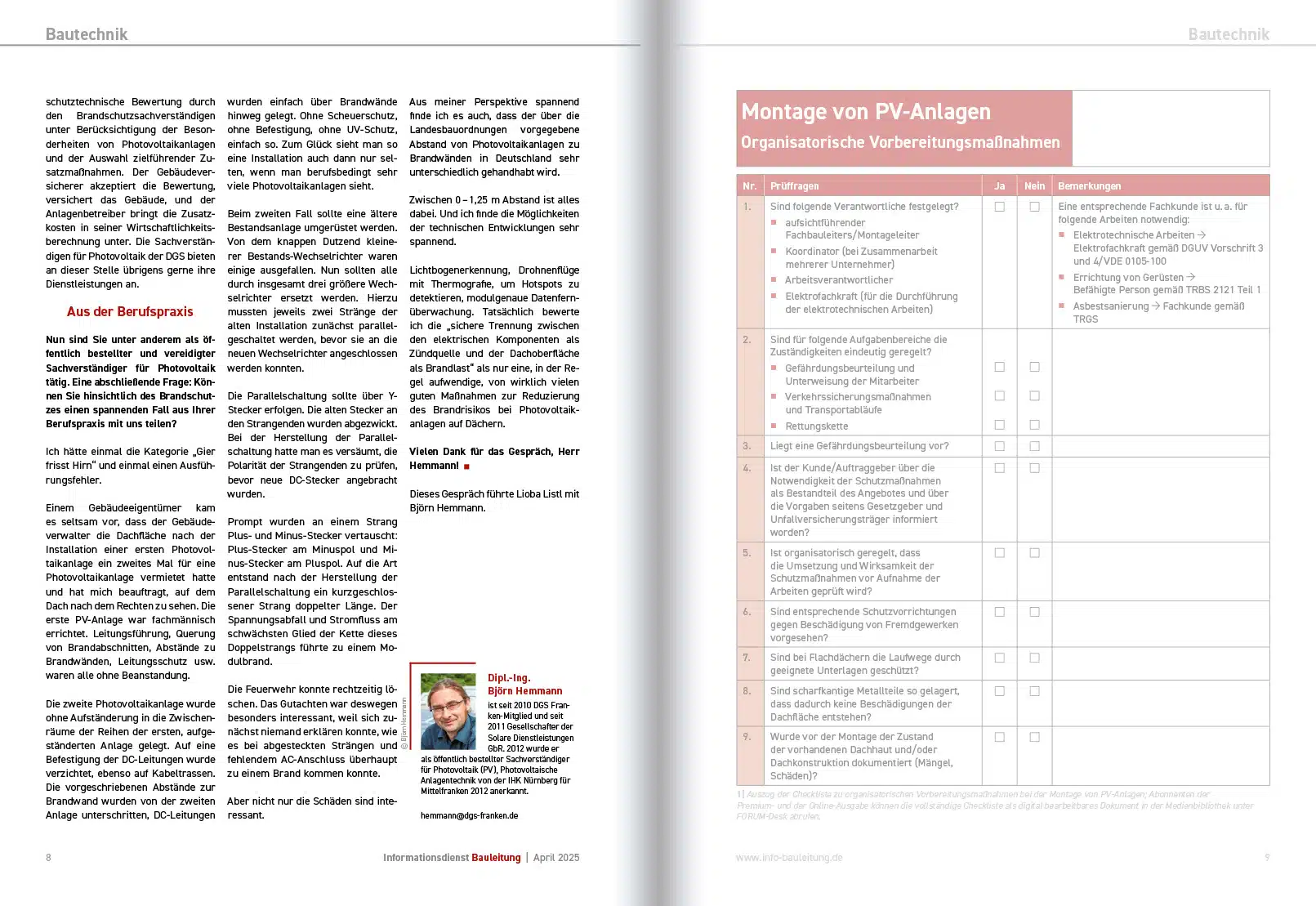BAUTECHNIK
Ein Interview mit Fachexperte Björn Hemmann: Brandschutz bei PV-Anlagen
Text: Dipl.-Ing. Björn Hemmann | Foto (Header): © RioPatuca Images – stock.adobe.com
Kommt das Gespräch auf PV-Anlagen, ist auch immer wieder von Gefahren für den Brandschutz die Rede. Doch stellen diese tatsächlich ein Risiko dar, das es aus brandschutztechnischer Sicht zu beachten gilt? Fachexperte Dipl.-Ing. Björn Hemmann gibt einen Überblick über Normen und Richtlinien, an die es sich zu halten gilt, und klärt auf, wie schon bei Planung und Installation auf Schadensverhütung geachtet werden kann.
Auszug aus:
Informationsdienst Bauleitung
Ausgabe April 2025
Jetzt Leser/-in werden
INHALTE DES BEITRAGS
Normen und Richtlinien
VdS 6023: Umstritten?
Zur Sache: Brandschutz bei Neubau
Aus der Berufspraxis
Herr Hemmann, das Thema Brandschutz bei PV-Anlagen scheint aktueller denn je. Auch der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger (BVS) warnte im Oktober 2023 explizit vor Brandgefahren und spricht von vermehrten Zwischenfällen bei dem Betrieb einer solchen Anlage. Können Sie dieser Tendenz zustimmen?
Hemmann: Natürlich hat die Anzahl der Zwischenfälle zugenommen. Allerdings darf man diese Aussage nicht einfach so stehen lassen. Da die Anzahl der Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat, ist es nur logisch, dass bei gleichbleibender Gefahrenlage auch die Anzahl von Zwischenfällen zunimmt. Interessant ist also nicht die absolute Anzahl an Bränden, sondern die Quote bzw. die Gefahrenlage. Also zum Beispiel die Frage: „Wie viele von hundert PV-Anlagen haben einen Brand verursacht?“ Auf diese Frage gibt es leider keine regelmäßig veröffentlichten aktuellen Zahlen.
So kam es um das Jahr 2015 tatsächlich zu etwa 210 Fällen von Bränden mit der Brandursache in der PV-Anlage, allerdings bei 1,3 Mio. installierten Anlagen. 2023 waren bereits 3 Mio. Anlagen in Betrieb.
Mir ist weder aus unserer Verbandsarbeit bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. (DGS) noch aus meiner Sachverständigentätigkeit bekannt, dass sich an der Gefahrenlage groß etwas geändert hätte. Das bedeutet, dass wir 2023 weniger als 500 Brände durch PV-Anlagen gehabt haben sollten. Also ja, die Anzahl der Zwischenfälle ist gestiegen, und nein, PV-Anlagen sind alles andere als brandgefährlich und werden auch nicht gefährlicher.
Normen und Richtlinien
Ganz grundsätzlich: Welche Normen und Richtlinien müssen denn bei Planung und Installation einer PV-Anlage beachtet werden?
PV-Anlagen sind elektrische Anlagen, also gilt zunächst vor allem der Normenkreis VDE 0100 „Errichten von Niederspannungsanlagen“. Das ist der Standard für die Elektriker. Dazu gibt es etwa ein halbes Dutzend spezieller PV-Normen, wie die VDE 0100-712 oder die VDE 0126-23-1. Dort ist der PV-Fachmann gefragt.
Weiterhin gibt es Richtlinien über die diversen Schnittstellen, also zum Beispiel PV-Anlage und Gebäude, öffentliches Netz der Stromversorgung, Dach oder Elektroinstallation im Gebäude. Auch die Versicherungen bringen sich über Richtlinien ein.
Elektroinstallation, Dach, Netz, Blitzschutz, Brandschutz, Statik, … Man sieht schon: Bei PV-Anlagen ist gewerkeübergreifendes Planen und Installieren gefragt. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, mit qualifizierten Fachfirmen zusammenzuarbeiten.
Gehen Sie gerne konkreter darauf ein. Welche Maßnahmen können im Vorfeld ergriffen werden, um aus Sicht des Brandschutzes bei der Planung und der Installation einer PV-Anlage bereits Schäden zu verhüten?
Die häufigsten Gründe für Brände durch PV-Anlagen sind fehlerhafte Installationen, Schäden an DC-Verkabelungen und defekte Komponenten. DC-Stecker und Leitungen müssen konsequent fachmännisch behandelt werden. Stecker dürfen nicht auf dem Dach zu liegen kommen. Leitungen sind unter den PV-Modulen gut zu befestigen.
Für die Leitungsführung gibt es Normen, Standards und Komponenten, die situationsbezogen auszuwählen sind. Wenn Leitungen einen Brandabschnitt queren sollen, muss eine Brandweiterleitung verhindert werden.
Bei der Installation von PV-Modulen und Leitungsanlagen über oder auf brennbaren Materialien, wie zum Beispiel Foliendächern, gilt es, die Bedürfnisse des Gebäudeversicherers, Gebäudeeigentümers und PV-Anlagenbetreibers zu berücksichtigen. Auch kleine Anlagen sollten mit einer Datenfernüberwachung ausgestattet sein, die den Betreiber bereits vor einem echten Fehler auf Unregelmäßigkeiten hinweist. Nicht normativ verpflichtend, aber in Diskussion ist die Lichtbogenerkennung. Lichtbögen können Brände entzünden. Sie frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden, reduziert das Brandrisiko.
Zwischen einmal pro Jahr und spätestens alle vier Jahre sind Instandhaltungsmaßnahmen und Prüfungen vorgeschrieben. Die kann der Laie nicht selbst vornehmen. Bei kleinen Anlagen im privaten Bereich würde ich die Kontrolle durch den Errichter etwa alle vier Jahre vorschlagen. Bei großen Anlagen im gewerblichen Bereich je nach Situation zwischen jährlich und alle vier Jahre durch den Errichter oder einen Sachverständigen.
VdS 6023: Umstritten?
Lassen Sie uns speziell auf die Richtlinie VdS 6023 des Verbands der Sachversicherer (VdS) aus dem Februar 2023 eingehen, welche nicht ganz unumstritten ist. Was legt diese fest und welche Neuerungen ergeben sich daraus?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, denn die VdS 6023 legt eigentlich gar keine konkreten Maßnahmen fest. Sie leitet mit einem Einzelfall aus dem Jahr 2013 ein. Sie reißt ein Zitat aus einem Gerichtsurteil aus dem Zusammenhang und behauptet darauf aufbauend, dass sich grundsätzlich die Frage stellt, ob PV-Anlagen auf Dächern von Industrie- und Gewerbegebäuden oder kommunalen Einrichtungen überhaupt noch errichtet werden dürfen. Wenn ich über die DGS mit der VdS 6023 in Kontakt komme, dann stets nur wegen dieser Behauptung.
Die VdS 6023 sagt in Kapitel 1 aber auch explizit, dass bei fachgerechten PV-Anlagen die Gefahr unterhalb des akzeptierten Risikos verbleibt und man von einer vorhandenen Sicherheit ausgehen darf. Oder als Zitat aus Kapitel 2: „Ordnungsgemäß geplante, errichtete und regelmäßig instandgehaltene PV-Anlagen gelten als sicher.“
Im Ganzen gelesen, sagt die VdS 6023 Folgendes:
Fachgerecht errichtete und instand gehaltene PV-Anlagen gelten als sicher. Wenn ein besonderes Risiko festgestellt wird, können über die normativen Mindestanforderungen hinausgehende Maßnahmen gefordert werden.
Zum Beispiel auf Dächern mit brennbaren Baustoffen die Lichtbogenerkennung oder eine besonders geschützte Leitungsführung.
Die Neuerung sollte also sein, dass man die Tatsache, dass in seltenen Fällen eine PV-Anlage einen Brand verursachen kann, intensiver bewertet sowie die grundlegende Brennbarkeit einiger Dachaufbauten mehr berücksichtigt und, dass man gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreift. Umstritten ist die Richtlinie vor allem, da sie viel zu häufig so interpretiert wurde, dass auf Gebäuden mit brennbaren Dachaufbauten gar keine PV-Anlagen mehr errichtet werden dürfen beziehungsweise die Gebäude dann nicht mehr versichert werden können.
Wie bewerten Sie diesen Sachverhalt – ist dieser neuen Richtlinie nun zwingend Folge zu leisten?
Ich bedaure den Sachverhalt, dass Versicherer eine Passage aus dem Gerichtsurteil aus der Einleitung der Richtlinie als unumstößliche Vorgabe bewertet haben, was zur Folge haben soll, dass eine PV-Anlage konkret so installiert werden müsse, „dass eine sichere Trennung zwischen den elektrischen Komponenten als Zündquellen und der Dachoberfläche als Brandlast gewährleistet ist“.
Diese Aussage steht so in keiner Norm und ist auch keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Sie ist schlicht ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat. In dem Gerichtsverfahren, aus dessen Urteil das Zitat stammt, ging es um die Klärung der Haftung zwischen den Parteien, nicht um das Setzen eines neuen Installationsstandards. Ob der Richtlinie zwingend Folge zu leisten ist, kann nicht so leicht beantwortet werden. Die Richtlinie fordert ja, wie bereits gesagt, nichts wirklich Neues.
Wenn ein Sachversicherer aber ein Gebäude nicht länger versichern will, weil eine PV-Anlage darauf errichtet werden soll und obigen Auszug aus besagtem Gerichtsurteil zitiert, dann steht der Gebäudeeigentümer vor einem Problem. Ohne kompetente Unterstützung und intensive Gespräche mit dem Sachversicherer zu allen Aussagen der VdS 6023 kommt man dann nicht voran.
Grundsätzlich sollte klar sein, dass die VdS 6023 von ihrem Status her unverbindlich ist. Sie ist unterhalb von Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuordnen. Macht ein Sachversicherer eine Passage aber zu seinem Vertragsbestandteil, so steht ein gültiger Vertrag sogar über Normen.
Zur Sache: Brandschutz bei Neubau
Nach einem Überblick über Richtlinien und Normen in diesem Bereich nun der konkrete Fall des Neubaus eines Daches, auf dem später eine PV-Anlage realisiert werden soll. Worauf sollte aus brandschutztechnischer Sicht gleich beim Neubau des Daches Wert gelegt werden?
Auf die Risikobetrachtung. Mit ihr beginnt die richtige Vorgehensweise. Handelt es sich um ein mit Ziegeln gedecktes Schrägdach eines Einfamilienhauses, fordert kein Sachversicherer zusätzliche Maßnahmen. Bei so einem Neubau wird man daher gar keine Risikobetrachtung vornehmen. Und, wie bereits bemerkt, „ordnungsgemäß geplante, errichtete und regelmäßig instandgehaltene PV-Anlagen gelten als sicher“. Daher gibt es auch für Flachdächer von Industrie-, Gewerbe- oder kommunalen Gebäuden kein umfangreiches Pflichtenheft zusätzlicher Maßnahmen.
Möchte man sich sicherheitshalber bautechnisch vorbereiten, vielleicht, weil man Inhalt und Wert des Neubaus noch gar nicht genau genug kennt, dann kann beispielsweise eine nichtbrennbare Dachdämmung und eine nichtbrennbare Dachhaut mit Kies oder aus Blech eingebaut werden.
Später, beim Errichten der PV-Anlage, kann man die Leitungsführung in Kabelrinnen aus Metall ausführen und ggf. zusätzlich aufständern. Das Material der Dachabdichtung lässt sich im Nachhinein am wenigsten beeinflussen. Daher sollte v. a. hier eine bewusste Wahl, ggf. zusammen mit dem Versicherer des Gebäudes, getroffen werden.
PV-Anlagen sind in manchen Fällen sogar integriert in die Bedachung. Welche Besonderheiten gilt es bei Indach-Anlagen aus brandschutztechnischer Sicht zu beachten?
Indach-Anlagen sind in Deutschland selten. Der Kundenwunsch oder Anforderungen zum Beispiel aus dem Denkmalschutz können eine Rolle bei der Entscheidung spielen. Tatsächlich gilt, was wir bereits gesagt haben: Die fachgerechte Installation und eine Betriebsführung mit regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen sind wichtig. Bei Indach-Anlagen ist die Schnittstelle zum Dach besonders ausgeprägt, das Dachhandwerk ist gefragt. Nach der Installation kann man Stecker und die Leitungsführung nicht mehr einsehen. Hier muss dieser elektrische Teil also besonders sorgfältig ausgeführt werden.
Herr Hemmann, nun stellt sich die Praxis immer etwas anders als die Theorie dar. Auch bauliche Einschränkungen, die ein regelkonformes Befolgen der brandschutztechnischen Richtlinien und Ordnungen nicht erlauben, sind denkbar. Wie kann in strittigen Fällen weiter verfahren werden? Wie können brandschutztechnische Fragestellungen geklärt werden?
Wie so häufig hilft ein aufklärendes Gespräch. Wenn alle am Tisch sitzen, dann haben wir den Gebäudeeigentümer, den PV-Anlagenbetreiber, den Versicherer des Gebäudes, einen Fachmann oder Sachverständigen für Brandschutzfragen sowie einen für Photovoltaikanlagen. Die einen bringen Wünsche mit, die anderen Fachwissen.
Der Gebäudeeigentümer möchte sein Gebäude versichert wissen, der PV-Anlagenbetreiber keine Kosten für überzogene Maßnahmen tragen. Sollte die VdS 6023 der Startpunkt des Gesprächs sein, dann würde ich empfehlen, zuerst die Sache mit dem Zitat aus dem Gerichtsurteil zurechtzurücken. Mit dem Wissen über Brandentstehung, Brandausbreitung und Brandbekämpfung sowie mit dem Wissen über Planung, Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen finden sich Lösungen.
Einige wurden bereits bei der Frage nach den Maßnahmen vorgestellt, die bereits im Vorfeld ergriffen werden können. Und Mikro-, also Modul-Wechselrichter und Leistungsoptimierer als weitere Möglichkeiten, das Brandrisiko zu minimieren, haben wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen.
Minimallösung wäre eine PV-Anlage ohne Zusatzmaßnahmen. Der Gebäudeversicherer stimmt dem zu, niemandem entstehen Zusatzkosten. Maximalösung wäre zum Beispiel eine situationsbezogene brandschutztechnische Bewertung durch den Brandschutzsachverständigen unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Photovoltaikanlagen und der Auswahl zielführender Zusatzmaßnahmen. Der Gebäudeversicherer akzeptiert die Bewertung, versichert das Gebäude, und der Anlagenbetreiber bringt die Zusatzkosten in seiner Wirtschaftlichkeitsberechnung unter. Die Sachverständigen für Photovoltaik der DGS bieten an dieser Stelle übrigens gerne ihre Dienstleistungen an.
Aus der Berufspraxis
Nun sind Sie unter anderem als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Photovoltaik tätig. Eine abschließende Frage: Können Sie hinsichtlich des Brandschutzes einen spannenden Fall aus Ihrer Berufspraxis mit uns teilen?
Ich hätte einmal die Kategorie „Gier frisst Hirn“ und einmal einen Ausführungsfehler.
Einem Gebäudeeigentümer kam es seltsam vor, dass der Gebäudeverwalter die Dachfläche nach der Installation einer ersten Photovoltaikanlage ein zweites Mal für eine Photovoltaikanlage vermietet hatte und hat mich beauftragt, auf dem Dach nach dem Rechten zu sehen. Die erste PV-Anlage war fachmännisch errichtet. Leitungsführung, Querung von Brandabschnitten, Abstände zu Brandwänden, Leitungsschutz usw. waren alle ohne Beanstandung.
Die zweite Photovoltaikanlage wurde ohne Aufständerung in die Zwischenräume der Reihen der ersten, aufgeständerten Anlage gelegt. Auf eine Befestigung der DC-Leitungen wurde verzichtet, ebenso auf Kabeltrassen. Die vorgeschriebenen Abstände zur Brandwand wurden von der zweiten Anlage unterschritten, DC-Leitungen wurden einfach über Brandwände hinweg gelegt. Ohne Scheuerschutz, ohne Befestigung, ohne UV-Schutz, einfach so. Zum Glück sieht man so eine Installation auch dann nur selten, wenn man berufsbedingt sehr viele Photovoltaikanlagen sieht.
Beim zweiten Fall sollte eine ältere Bestandsanlage umgerüstet werden. Von dem knappen Dutzend kleinerer Bestands-Wechselrichter waren einige ausgefallen. Nun sollten alle durch insgesamt drei größere Wechselrichter ersetzt werden. Hierzu mussten jeweils zwei Stränge der alten In stallation zunächst parallelgeschaltet werden, bevor sie an die neuen Wechselrichter angeschlossen werden konnten.
Die Parallelschaltung sollte über YStecker erfolgen. Die alten Stecker an den Strangenden wurden abgezwickt. Bei der Herstellung der Parallelschaltung hatte man es versäumt, die Polarität der Strangenden zu prüfen, bevor neue DC-Stecker angebracht wurden.
Prompt wurden an einem Strang Plus- und Minus-Stecker vertauscht: Plus-Stecker am Minuspol und Minus-Stecker am Pluspol. Auf die Art entstand nach der Herstellung der Parallelschaltung ein kurzgeschlossener Strang doppelter Länge. Der Spannungsabfall und Stromfluss am schwächsten Glied der Kette dieses Doppelstrangs führte zu einem Modulbrand.
Die Feuerwehr konnte rechtzeitig löschen. Das Gutachten war deswegen besonders interessant, weil sich zunächst niemand erklären konnte, wie es bei abgesteckten Strängen und fehlendem AC-Anschluss überhaupt zu einem Brand kommen konnte.
Aber nicht nur die Schäden sind interessant.
Aus meiner Perspektive spannend finde ich es auch, dass der über die Landesbauordnungen vorgegebene Abstand von Photovoltaikanlagen zu Brandwänden in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Zwischen 0 – 1,25 m Abstand ist alles dabei. Und ich finde die Möglichkeiten der technischen Entwicklungen sehr spannend.
Lichtbogenerkennung, Drohnenflüge mit Thermografie, um Hotspots zu detektieren, modulgenaue Datenfernüberwachung. Tatsächlich bewerte ich die „sichere Trennung zwischen den elektrischen Komponenten als Zündquelle und der Dachoberfläche als Brandlast“ als nur eine, in der Regel aufwendige, von wirklich vielen guten Maßnahmen zur Reduzierung des Brandrisikos bei Photovoltaikanlagen auf Dächern.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hemmann!
Dieses Gespräch führte Lioba Listl mit Björn Hemmann.
Der Autor
Dipl.-Ing. Björn Hemmann ist seit 2010 DGS Franken-Mitglied und seit 2011 Gesellschafter der Solare Dienstleistungen GbR. 2012 wurde er als öffentlich bestellter Sachverständiger für Photovoltaik (PV), Photovoltaische Anlagentechnik von der IHK Nürnberg für Mittelfranken 2012 anerkannt.
hemmann@dgs-franken.de